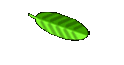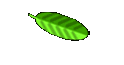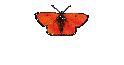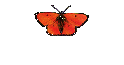| |  | |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  | | Auf dieser Seite bringe ich euch weitere Meldungen und News die sicherlich sehr informativ sein dürften. | | | | Informationsdienst Wissenschaft - idw - - Pressemitteilung
Deutsche Krebshilfe e. V., 26.06.2002
Die Lebensader des Tumors kappen
Blockade der Blutgefäßbildung soll Krebswachstum hemmen
Hamburg (nh) - "Wir wollen bösartige Tumoren aushungern, indem wir ihnen
die Nährstoffzufuhr entziehen", sagt Professor Dr. Christoph Wagener,
Direktor des Instituts für Klinische Chemie am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf. Denn Krebszellen können ohne Sauerstoff und
Nährstoffe nicht überleben. Sie zapfen das körpereigene Blutsystem an,
wobei sie ihre Zellumgebung zur Neubildung von Adern anregen. Dafür
benötigen sie die Unterstützung eines speziellen Gens. Diese Tatsache
machen sich Professor Wagener und sein Team bei einem Forschungsprojekt
zunutze, das die Deutsche Krebshilfe mit rund 254.000 Euro fördert.
"Wenn es gelingt, das für die Blutgefäßbildung verantwortliche Gen
auszuschalten, könnte die Versorgung des Tumors verhindert und sein
Wachstum gebremst werden", erklärt Professor Wagener.
Die Neubildung von Blutgefäßen ist ein natürlicher Prozess. Die so
genannte Angiogenese findet beim Menschen aber nur selten statt, etwa
bei der Wundheilung oder während des Menstruationszyklus. Beim
Krebswachstum kommt diesem Mechanismus jedoch eine besondere Bedeutung
zu: Ab einem Durchmesser von etwa einem Millimeter benötigt jeder Tumor
den Anschluss an das körpereigene Versorgungssystem, um weiterwachsen zu
können. Die bösartigen Zellen senden Botenstoffe aus, um die bestehenden
Blutbahnen anzuregen neue Gefäße zu bilden. Diese vom Tumor ausgelöste
Gefäßbildung wird als Tumorangiogenese bezeichnet.
Die Wände der Blutgefäße sind mit Endothelzellen ausgekleidet. Diese
Zellen sind maßgeblich an der Bildung von neuen Blutbahnen beteiligt.
Bei der Entstehung von neuen Adern sprossen die Endothelzellen aus
vorhandenen Gefäßen aus und wachsen als rohrförmige Öffnung in den Tumor
hinein. Die neu gebildeten Blutgefäßzellen müssen miteinander verknüpft
werden. Diese Verbindung wird von spezialisierten Eiweißstoffen
übernommen. Diese Proteine, die als Zelladhäsionsmoleküle bezeichnet
werden, sitzen an der Oberfläche der Endothelzellen und vernetzen die
Blutgefäße zu einem funktionsfähigen Versorgungssystem. Im Verbund mit
anderen Zellen bildet sich so ein neues Gefäßnetz im Tumor. Über dieses
System sind die Krebszellen an das Blutsystem des Körpers angebunden und
werden mit den notwendigen Nährstoffen versorgt.
In der Abteilung für Klinische Chemie der Klinik und Poliklinik für
Innere Medizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf versuchen
Wissenschaftler detaillierte Einblicke in die Rolle der
Zelladhäsionsmoleküle im lebenden Organismus zu gewinnen. Die Forscher
unter der Leitung von Professor Dr. Christoph Wagener interessiert
besonders die genaue Funktionsweise des Zelladhäsionsproteins CEACAM-1.
"Versuche haben gezeigt, dass dieses Protein an der Blutgefäßbildung
beteiligt ist", so der Mediziner. Nun wollen die Hamburger
Wissenschaftler untersuchen, ob durch gezielte Blockade des
CEACAM-1-Gens die Ausbildung neuer Blutbahnen und damit die
Tumorangiogenese gehemmt werden kann. Die Krebszellen könnten dadurch
von ihrer Lebensader abgeschnitten werden.
"Wir erwarten, dass eine Therapie, die die Blutgefäßbildung hemmt, nur
wenige Nebenwirkungen verursacht", sagt Professor Wagener, "denn beim
Menschen werden nur in seltenen Fällen neue Adern gebildet". Den Tumor
indirekt über die Blutversorgung anzugreifen sei also sehr vorteilhaft.
Als Fernziel des Projektes nennt der Mediziner: "Ergebnisse unserer
Versuche könnten die Grundlage für die Entwicklung von Medikamenten
liefern, die das Wachstum menschlicher Tumoren hemmen".
Interviewpartner auf Anfrage!
Projekt 10-1723
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.krebshilfe.de
Art: überregional, Forschungsprojekte
Sachgebiete: Medizin und Gesundheitswissenschaften
Informationsdienst Wissenschaft - idw -
Ein Projekt der Universitäten Bayreuth, Bochum und der TU Clausthal
Im WWW: http://idw-online.de/
Kontakt-Adresse: service@idw-online.de
|
| |
| | | | Informationsdienst Wissenschaft - idw - - Pressemitteilung
Deutsche
Krebshilfe e. V., 17.07.2002 Diagnoseverbesserung bei Eierstock- und Gebärmutterkrebs Den stummen Killer früh erkennen Heidelberg (nh) - Tumoren der Eierstöcke werden oft zu spät erkannt und haben dann nur noch geringe Heilungschancen. Der Hauptgrund liegt darin, dass das so genannte Ovarialkarzinom im Frühstadium keine Beschwerden macht. Auch bei Gebärmutterkrebs ist die Diagnose schlecht, wenn eine besonders aggressive Form dieses Tumors vorliegt und nicht rechtzeitig erkannt wird.
Wissenschaftler um Professor Dr. Peter Altevogt vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg wollen jetzt die rechtzeitige Diagnose verbessern. Sie untersuchen einen speziellen Eiweißstoff, der als Tumormarker dienen könnte. Die Deutsche Krebshilfe fördert das Projekt mit rund 194.000 Euro. Ein Tumor in den Eierstöcken kann längere Zeit unbemerkt wachsen, weil die Eierstöcke frei in der Bauchhöhle hängen und der Tumor viel Platz hat. Bevor die betroffene Frau Schmerzen oder andere
Beschwerden spürt, ist es oft zu spät: Zwei Drittel der Tumoren haben dann bereits außerhalb der Eierstöcke Metastasen gebildet. In einem solchen Fall sind die Heilungschancen sehr schlecht. Das Ovarialkarzinom wird daher auch "silent Killer" (stummer Killer) genannt. Rund 7.400 Frauen erkranken in Deutschland jährlich an einer Krebserkrankung der Eierstöcke. Damit macht diese Krebsform etwa vier Prozent aller bösartigen Neuerkrankungen bei Frauen aus. Tumoren der Gebärmutter treten
mit etwa 17.200 Neuerkrankungen pro Jahr als eine der häufigsten Krebsneuerkrankungen bei Frauen auf. Sie gelten aber meist als weniger gefährlich. "Bei diesem Tumor besteht ein besonderes Problem darin, dass eine kleine Gruppe der Patientinnen eine sehr aggressive Form trägt, die nur schwer zu erkennen ist", erklärt Professor Altevogt. "Wird diese nicht rechtzeitig diagnostiziert, sind die Überlebensraten sehr schlecht". Bis jetzt gibt es in der klinischen Praxis keine
gut geeignete Möglichkeit, die betroffenen Frauen frühzeitig zu erkennen. "Eine frühe Diagnose der Tumoren bietet die größte Chance für die Senkung der Sterberate", sagt Professor Altevogt. Unter seiner Leitung untersuchen Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg und vom Kaplan Hospital in Rehovot, Israel ein Protein, das im Körper vielfältige Funktionen übernimmt und möglicherweise auch für die Tumorentwicklung der Eierstöcke und der Gebärmutter
verantwortlich ist. Beide Tumorformen produzieren diese Substanz bereits in einem frühen Stadium und geben sie ins Blut ab. "Dieses so genannte L1 Adhäsionsmolekül könnte bereits beim ersten Verdacht auf einen Tumor einen Hinweis auf die bösartige Krankheit liefern", vermutet Professor Altevogt. "Unser langfristiges Ziel ist es, durch Messen des L1-Proteins die "Risiko-Patientinnen" beim Gebärmutterkrebs und die frühen Stadien des Eierstockkrebses erkennen zu
können." Dadurch würden sich die Heilungschancen erhöhen, da die Patientinnen schon in einem frühen Stadium behandelt werden könnten. Projekt 10-1876 Bonn, 17.07.02 Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.krebshilfe.de ---- Art: überregional, Forschungsprojekte Sachgebiete: Medizin und Gesundheitswissenschaften
| |
| |
 | Ärzte Zeitung, 31.07.2002 http://www.aerztezeitung.de/docs/2002/07/31/142a0102.asp?nproductid=2320&narticleid=222922
Hyperthermie mit MRT-Kontrolle ist neue Chance für Krebskranke Erwärmung als adjuvante Therapie konnte bisher nicht sicher gesteuert
werden BERLIN (sko). Hyperthermie ist für Krebspatienten mit Rezidiven oder inoperablen Tumoren eine gute Therapie-Option. Doch bisher konnte die Erwärmung im Tumor mit Kathetern nur ungenau bestimmt werden. Mit der an der Charité entwickelten Hybrid-Hyperthermie ist nun die farbige Darstellung
räumlicher Temperaturänderungen möglich. "Früher hieß es immer: Sie wissen ja nicht, was sie tun!", beschreibt Professor Peter Wust von der Berliner Charité die Worte der Kritiker. Denn der Ruf der Hyperthermie, bei der Tumorzellen durch Erwärmung auf bis zu 43 Grad für eine Chemo- oder
Strahlentherapie sensibilisiert oder direkt zerstört werden, habe durch falsche Ausführung gelitten, so der Radiologe. Die Hybrid-Hyperthermie - Hybrid verdeutlicht, daß das System aus zwei Komponenten besteht - ist für Patienten mit Zervix-, Prostata-, Blasen- oder Colon-Ca geeignet. Während der etwa
anderthalbstündigen Behandlung wird die entsprechende Körperpartie mit einem Plastikring mit Antennen, die Radiowellen von 100 Megahertz in den Tumor strahlen, umschlossen. Mit einem MRT wird die Wärmeentwicklung im Körper während der ganzen Behandlung überwacht und auf einem Bildschirm farbig dargestellt. "Mit
dem Gerät können wir die Hyperthermie jetzt routinemäßig einsetzen", so Wust im Gespräch mit der "Ärzte Zeitung". 40 Patienten haben die Ärzte der Charité schon behandelt. Außerdem ermöglicht die Überwachung der Temperaturentwicklung eine noch bessere Therapie: "Unser Ziel ist es in Zukunft, das Potential unseres Applikators voll auszunutzen und höhere Temperaturen zu erzeugen. Das war bisher zu riskant, da wir die Wärmeentwicklung nicht überprüfen konnten", so Wust.
Copyright © 1997-2002 by Ärzte Zeitung |
|